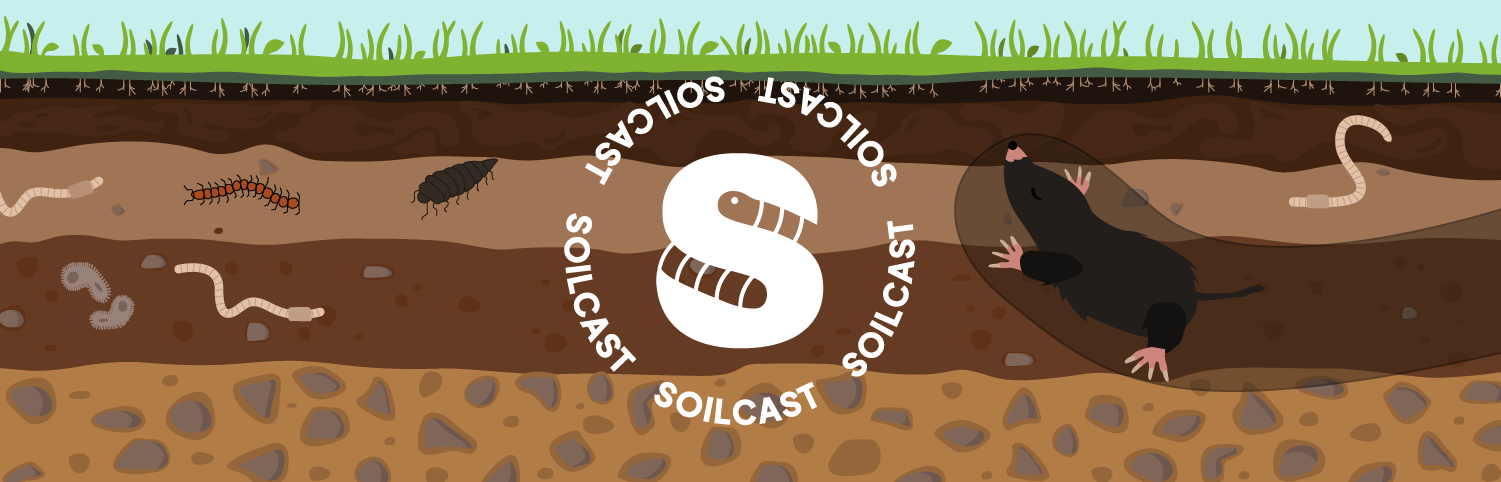Wulf Grube kann auf über 30 Jahre Berufserfahrung in einer unteren Bodenschutzbehörde zurückblicken. Er erklärt euch in dieser Folge, welche fachlichen Voraussetzungen man für diese Tätigkeit mitbringen sollte und welche Aufgaben ihn im Berufsalltag erwarten.
- www.soilcast.de
- E-Mail: info@soilcast.de
- Soilcast auf Bluesky
- Soilcast auf X, ehem. Twitter
- Soilcast auf Instagram
- Soilcast auf Facebook
Interview: Bodenkundliches Berufsfeld Behörde
Wulf arbeitet beim Landkreis Hildesheim.